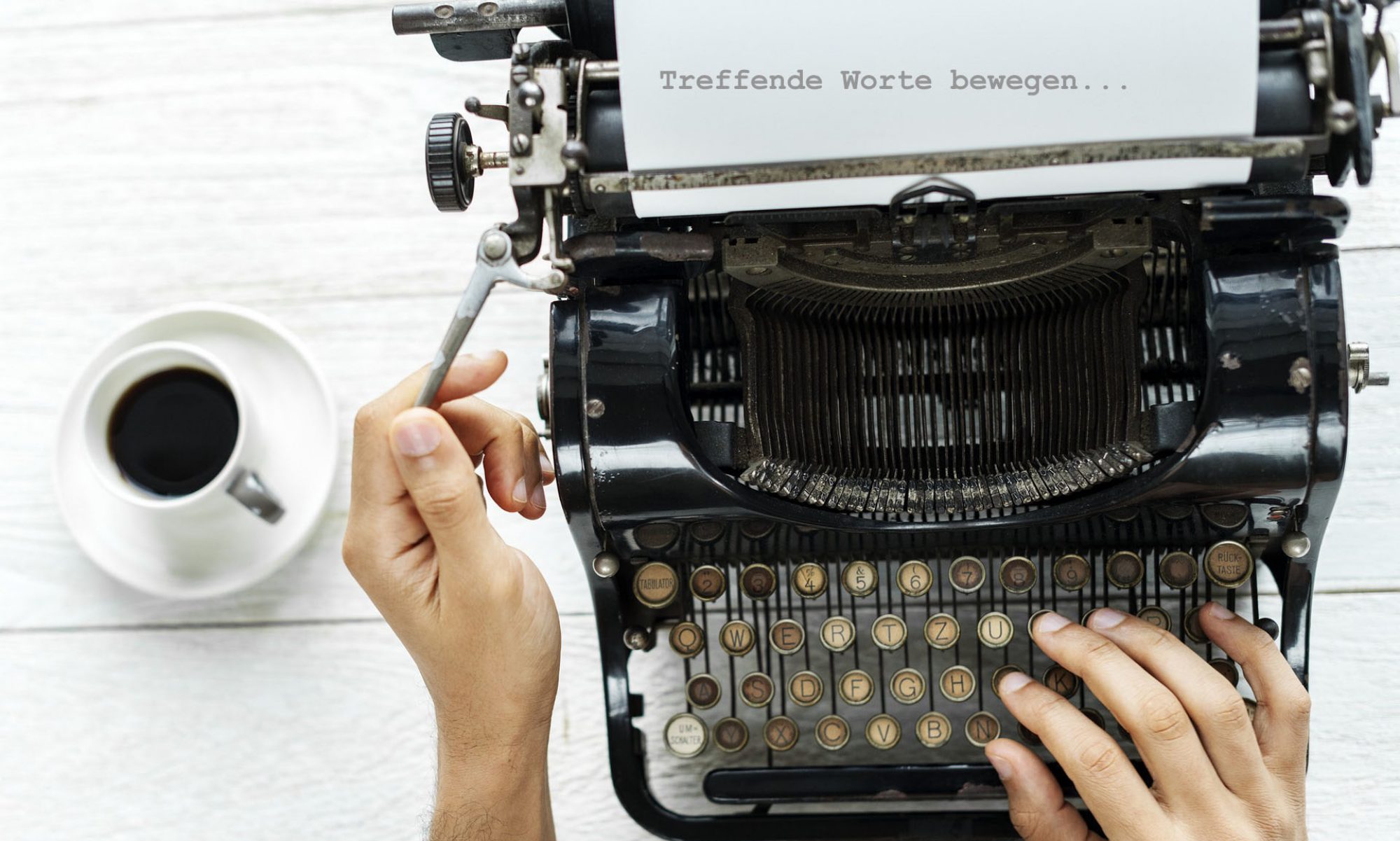1991 „zerbrach“ die Sowjet-Union, die Ukraine wurde selbständig. In der „Spiegel-Schicht“ bei „Maul-Belser“ lernten wir uns 1993 kennen, an den Maschinen, wo aus Umschlags- und Inhaltsseiten das Wochenmagazin „Spiegel“ hergestellt wurde. Ein Brotjob für uns. Wir – Peter Budig/Peter Roggenthin träumten von großem Journalismus und trauten uns was: Wir fuhren auf eigene Kosten in die Ukraine, nach Charkov. Wir wollten berichten, wie dort der Bau der Reformsynagoge voran ging. Dies ist die Reisegeschichte zur Synagogen-Reportage.
Eine Reiseerzählung aus dem Jahr 1994 von Peter Budig /Text
und Peter Roggenthin/Fotos
Reisen in den Osten sind heute, nach der Öffnung der Grenzen, ein Kinderspiel. Man beantragt ein Visum, bekommt es vergleichsweise einfach in wenigen Tagen, und schon kann’s losgehen. Wer in die Ukraine will, zum Beispiel nach Charkow (sprich: ha:rkof), 600 Kilometer östlich von Kiew nahe der russischen Grenze, dem stehen verschiedene Reisewege offen. Man kann für gut 1000 Mark mit dem Flugzeug ab Frankfurt, München oder Berlin nach Kiew fliegen, in dreieinhalb Stunden. Ziemlich genau die Hälfte kostet die Bahnfahrt über Warschau, gebucht in Deutschland. Individualisten – also Menschen ohne Spesenkonto – fahren wie auch immer nach Prag, von dort geht täglich der Zug Prag – Moskau über Kiew, er kostet bis in die ukrainische Hauptstadt etwa 200 Mark, Schlafwagen inklusive, Studenten zahlen ein Drittel weniger.
Die Anreise über Prag hat einen weiteren Vorteil: man kann sich schon mit dem vertraut machen, was der Sozialismus übriggelassen hat, an Menschen, Gebäuden, Illusionen… Wesentliche Ingredienzien post-sozialistischer Lebensart sind die Gier nach Devisen und allem, was man für Devisen losschlagen kann; sind kaputte, verrußte Fassaden, die müllhalden-ähnliche Treppenhäuser verbergen; sind begrabene Träume und völlig verdreckte, leckende Toiletten. Trotzdem bedeutet Prag, Abschied zu nehmen: Abschied von der Möglichkeit, für sein Geld etwas zu erhalten (zum Beispiel ein schmackhaftes Mittagessen oder ein vorzügliches Bier); von funktionierenden Telefonen, regelmäßig verkehrenden Bussen, hübschen privaten Pensionen, gefüllten Ladenregalen, Menschen, die Deutsch oder Englisch sprechen, von allem, was wir fraglos als Standard ansehen. Prag wird das goldene Tor zum Osten genannt, was dahinterliegt, sind verdorrte Steppen; versteppte Landschaften, Städte, Menschen – eine gigantische, deprimierende Frustlandschaft breitet sich aus.
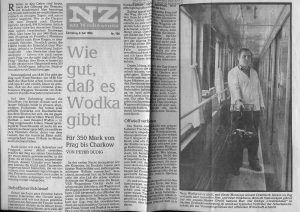
Zeitungsveröffentlichung in der „Nürnberger Zeitung“, Juli 1994.
Sonntagabend um 19.00 geht der Zug nach Kiew/Moskau, um 18.30 läuft die Maschine schon warm, hustet und spuckt und raucht, kaum zu glauben, daß sie die zwei Dutzend grau-braunen Waggons tausende von Kilometern über die Karpaten ziehen wird.
Auf dem Bahnsteig stehen die Schaffner, ein kleiner, dünner und ein langer Schlaks, beide in grauen, abgewetzten Uniformen. Sie haben prall gefüllte Seesäcke mit Kostbarkeiten aus dem Westen bei sich, die sie gegen die wenigen konvertiblen Waren ihrer Heimat – zum Beispiel Wodka – in Prag eingetauscht haben. Dieser privilegierte Tauschhandel ist mehr als ein lukratives Zusatzgeschäft, sie ernähren ihre Familien davon, denn von dem Gehalt, das die russische Bahn zahlt, umgerechnet keine 15 Mark im Monat, kann niemand leben.
Noch bevor wir zwei, Schreiber und Fotograf, unser Abteil erreichen, erzählt der Zug aus seiner Geschichte. Sie steigt einem förmlich in die Nase, denn überall stinkt es penetrant. Es ist kein frischer, unangenehmer Geruch, dessen Ursache man beseitigen könnte. Es stinkt nach tausenden ungewaschener Menschen, die vor uns reisten, ihre Ausdünstungen hängen in den Polstern und im Holz, sie wurden in vielen Jahren aufgesogen und werden ständig wieder abgegeben. Schon nach ein paar Stunden haben unsere Klamotten den Geruch angenommen und wir uns daran gewöhnt. Schlimm ist, daß man die Fenster in den überheizten Abteils nicht öffnen kann, nur auf dem Gang lassen sich zwei der Fenster etwas herunterschieben, nachdem sie der kleine Schaffner mit einem Spezialschlüssel aufgeschlossen hat.

Mit der Zeit kann man sich’s trotzdem ganz gemütlich einrichten; das Abteil ist geräumig und da der Zug halbleer ist, haben wir es ganz für uns. Am Ende eines jeden Waggons ist ein Wasserkocher in die Wand eingelassen, der von den Schaffnern immer nachgefüllt und heiß gehalten wird. Wie die russischen, ukrainischen, kirkisischen und chinesischen Mitreisenden brühen auch wir unseren Tee oder Schnellkaffee auf. Letzterer gehört im Osten zu den unerschwinglichen Kostbarkeiten. Als ich einmal abends einem hageren, etwa 50jährigen ukrainischen Bauern, der nach Moskau auf den Markt will, um seinen selbstgebrannten Wodka einzutauschen, eine Tasse anbiete, kommt er mit seiner Wegzehrung zu uns ins Abteil. Er spricht etwa 20-30 Wörter Deutsch und Englisch; wir ebensoviel Russisch, so unterhalten wir uns. Aber eigentlich will er gar nicht viel reden, er will nur Gesellschaft beim Trinken. „Trinken“ kann er auf Deutsch, dabei schnalzt er den Zeigefinger vom Daumen weg gegen den Hals, daß es knallt. Diese Geste ist im ganzen Osten wohlbekannt. Sie geht auf eine Geschichte, die sich im Zarenreich zugetragen haben soll, zurück: ein armer Bauer hatte seinem Zaren einen Gefallen getan und einen Wunsch frei. Er bat darum, sein Leben lang immer genug zu Trinken zu bekommen. Der Zar ließ auf seinen Hals den Befehl tätowieren, daß dem Mann immer und überall Wodka frei auszuschenken sei…
Die satten Jahre
Jetzt sitzt ein nicht so glücklicher Nachkomme jenes Bauern bei uns auf der Bank, schenkt 0,2-Liter-Gläser mit Wodka randvoll und ist ganz unglücklich, daß wir da nicht mithalten können. Vielleicht wenn wir etwas äßen, eine bessere Grundlage im Magen hätten? Er kramt in seinem Rucksack und zieht ein noch verschlossenes Glas mit eingemachtem Schweinefleisch und einen Laib Brot hervor. Mich erinnert das sofort an Karl May, an die Stelle, wo Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar auf den Spuren des Schut dahinreiten, und der kleine, treue Begleiter des großen deutschen Helden in einer geschenkten Wurst ein Stück eines blutigen Lederhandschuhs findet. Was ich durch das fettige Glas erkennen kann, läßt ähnliche Überraschungen befürchten, und ich verschwinde schleunigst in Richtung Toilette. Wie sind wir Westler doch alle verpimpelt, nach all den satten Jahren!
In der ersten Nacht überqueren wir die Karpaten, im Dunkeln lassen sich üppige Nadelwälder und tiefhängende, schwarze Wolken ausmachen; keuchend, manchmal fast im Schrittempo zieht die alte Lok die schier endlose Schlange der Waggons über die Berge. VEB Waggonbau Görlitz steht auf schmutzigen Schildern, die Wagen und die Zugmaschine wurden in der ehemaligen DDR hergestellt, die offenbar die ganze Sowjetunion belieferte. Irgendwann in den frühen Morgenstunden hält der Zug: erst die slowakischen, dann die ukrainischen Grenzer verlangen Pässe, Visum und Gepäck zu sehen. Etwa eine Stunde später erreichen wir Cop, den Bahnhof von Uzhgorod. Hier kann ich ein Schauspiel beobachten, daß mich schon als Junge staunen ließ, wenn mein Großvater davon erzählte: Alle Waggons werden angehoben und die schmalen Fahrgestelle durch breitere ersetzt. Das funktioniert wie beim Reifenwechsel, nur daß der Waggon gleichmäßig an allen vier Ecken hochgehievt wird. Die alten Fahrgestelle werden weggezogen, aufs Abstellgleis geschoben und durch neue, für die breiteren, ukrainisch-russischen Schienenstränge ersetzt.
Einmal kommt eine Durchsage über den Lautsprecher, kurze Lauteinheiten, Worte wie Peitschenknallen. Sie ist noch nicht zu Ende, als drei Frauen und ein Bub von etwa 11 Jahren, die auf dem Bahnsteig warten, hastig das Gepäck zusammenraffen. In der Ferne ist schon der angekündigte Zug zu erkennen, als die vier unter einem stehenden Zug verschwinden, um die angrenzenden Gleise zu überqueren. Erst läßt sich die älteste Frau die Mauer herab, bückt sich mühsam unter den Waggon; es folgt die Jüngste, der der Junge, dann das Gepäck nachgereicht wird. Ein Stationsschaffner steht daneben, tritt gleichgültig seine Zigarette aus. Zuletzt macht sich die dritte Frau auf den Weg. Mit vor Anstrengung hochrotem Gesicht schleift sie den kleineren Koffer hinter sich her. Rückwärts schiebt sie sich unter den Waggon, als plötzlich der ganze Zug einen Ruck tut, krächzend schiebt es ihn einen, zwei Meter voran. Gleich werden die hinteren Räder die Frau erfassen – da! Die Bremsen quietschen, einmal noch zittert der eiserne Koloß und steht still. Die Frau, einen Sekundenbruchteil vor Schreck erstarrt, verläßt geduckt die Falle-, minutenlang steht sie wie getroffen auf dem rettenden Bahnsteig und ich kann förmlich sehen, spüren, wie ihr Körper langsam das Adrenalin abbaut.
Gegen Mittag, als sich der Zug längst wieder durch die jetzt eintönige Landschaft schiebt; vorbei an Dörfern aus gebeugten Hütten, die aussehen wie Schrebergärten, an unzähligen halbfertigen Häusern, an Gruppen von lagernden Streckenarbeitern und -Arbeiterinnen, nur manchmal in immer ähnlichen Bahnhöfen haltend, durch eine hügelige, im April noch kahle, kalte Landschaft, halte ich es im Abteil nicht mehr aus. Gut zehn Waggons weiter hinten gibt’s ein Zugrestaurant. Über wacklige Wagenverbindungen, die oft weit auseinanderklaffen, kämpfe ich mich durch klemmende Türen zum Restaurant durch.
Die Tische sind gedeckt mit cremefarbener Tischdecke, Salz-und-Pfeffer-Streuern, umgedrehten Wassergläsern, dünnpapierenen Servietten. Am ersten Tisch langweilt sich das Personal; ein Koch, eine alte Frau, die später mit in der Küche verschwindet und zwei junge Bedienungen. Nach einigen Minuten steht eine auf, fragt mich etwas auf Russisch, ich bestelle Kaffee. Wie kleine, schwarze Butterklümpchen klebt die Wimperntusche in ihren Lidern. Langsam füllt sich das Restaurant, die meisten Gäste sind Männer, viele in Adidas-Trainingshosen und Lederjacken, der begehrten Freizeitkleidung aller, die es geschafft haben. Die ersten Speisen werden aufgetragen. Zwei ganz junge Burschen am Nebentisch haben offenbar ein Menü bestellt: eine trübe Brühe vorweg, dann Salat, welk und braun an den Rändern, die Hauptspeise ein Eintopf, kein Nachtisch. Ein Herr, der allein in Anzug und Krawatte hinter mir sitzt, bekommt Hühnchen mit Reis, eine Portion, die als Vorspeise lächerlich wäre, aber schmeckt, wie ich später selbst feststelle.
Abenteuer „Klogang“
Ab und zu kommt jemand kurz in den Speisewagen, ruft den Koch, der hier der Boss ist, redet kurz auf ihn ein und erhält eine Flasche Wodka, die der unter einem Tisch mit lange herunterhängender Decke hervorzieht. Alkoholgenuß ist in der Öffentlichkeit offiziell verboten, aber kaum jemand hält sich daran. Als ich zahlen will, reagiert die Bedienung unwillig auf mein ukrainisches Geld: „Kuponi njet“, sagt sie barsch; „Rubli, Rubli“. Schließlich ist das ein russischer Zug, das ukrainische Geld noch weniger wert als Rubel. Die hab ich nicht, also verlangt sie 2 Dollar, die nach einem kurzen Blick über die Schultern in einer Extratasche verschwinden. Später erfahre ich, daß zwei Dollar fast ein Wochenlohn sind.
Am Abend gegen zehn geh ich den weiten Weg nochmal, um nach piwo – Bier – zu fragen. Das Restaurant ist dunkel, durch einen Spalt der Küchentür fällt ein Streifen Lichts in den Gang. Schon will ich klopfen, da seh‘ ich die junge Bedienung vorgebeugt auf dem Küchenbrett sitzen, die Bluse weit geöffnet. Vor ihr steht der Koch, große rote Hände auf ihren gespreizten Schenkeln, ihre Hände sind unterhalb seines Gürtels beschäftigt, ihre Augen spielen mit den seinen. Im selben Augenblick bemerkt sie mich, ein schneller, kleiner Schreck huscht ihr übers Gesicht, dann lacht sie auf und gibt der Tür einen Tritt, daß sie krachend ins Scharnier fällt, durch die Wucht noch einmal aufspringt, vom Koch mit dem Hintern endgültig verhaftet wird. Auch in der Ukraine kann die Aussicht auf ein paar Dollars nicht alles aufwiegen.
Der Gang zur Toilette ist ein Abenteuer besonderer Art. In Frankreich, Italien, selbst der Türkei habe ich allerhand überstanden, dies hier stellt alles Erlebte in den Schatten: Rostige Wasserrohre, an den Verbindungsstellen tropfend, so daß im ganzen Raum sohlenhoch das Wasser steht. In einer Ecke ist ein winziges Wasserbecken aus Gußeisen festgeschraubt, unter dem Wasserhahn ragt ein Stift hervor, den man mit aller Kraft nach oben pressen muß, damit ein paar Tropfen Wasser herausrinnen – Waschen ist hier nicht vorgesehen. Die Toilette selbst hatte einmal eine schwarze Kunststoffbrille, von der noch ein Splitter am Scharnier hängt. Das ganze Becken, innen und außen, ist mit den hartgetrockneten Resten der vorigen Benutzer gesprenkelt – ich wende mich mit Grausen.
Irgendwann am dritten Tage, nach Mitternacht, fährt der Zug pünktlich in Kiew ein. Wann es Anschluß nach Charkow gibt, war in Prag nicht in Erfahrung zu bringen; jetzt hören wir, daß wir mehr als 12 Stunden warten müßten. Wir sind in Charkow verabredet, also versuchen wir es auf dem Bahnhofsvorplatz. Dort warten die privaten Fahrer; jeder, der ein Auto besitzt und einen Weg gefunden hat, sich Benzin zu besorgen, fährt Taxi. Wolgas, Wartburgs, ein Opel Admiral mit Lenkradschaltung, ein paar uralte japanische Kleinwagen, einige Skodas parken wild durcheinander. Die Fahrer stehen in Gruppen beieinander, in die rasch Bewegung kommt, als wir unseren Wunsch mitteilen. Nicht allein der Preis entscheidet, wer das Geschäft machen wird. Nur wenige verfügen über genügend heimliche Benzinreserven für eine so lange Fahrt. Schließlich erklärt sich ein junger, fülliger Mann mit Lederjacke bereit, uns für 150,- DM in die ferne Industriestadt zu bringen. Vorher müßten wir noch zu ihm, damit er genügend Kraftstoff laden kann. Wir haben in der ganzen Ukraine niemals eine geöffnete Tankstelle gesehen. Später war es ein beliebter Scherz, jeden, der uns transportierte, zu fragen, woher er den Sprit habe. Aber mehr als ein „Wer fahren will, muß sich den Stoff besorgen“ war nicht herauszubringen. Ein Kollege der Charkower Zeitung klärte uns auf: die „Mafia“ – in der Ukraine ist das der Begriff für jeden, der Westgeld verdient – kontrolliert den Benzinhandel, die Straßenmärkte, fast den ganzen freien Handel. Viele dieser Mafiosi stammen aus Kirkisien, fahren teure, nagelneue Westautos, tragen Designer-Sonnenbrillen und bündelweise Geldscheine lose in der Tasche, werfen mit Geld und Sprüchen um sich und sind im Volk verhaßt wie die Pest. Jeder, der sein Tischchen am Straßenrand aufstellen will, muß an die Mafia „Lizenzgebühren“ zahlen. Manche Verkäufer haben nur ein paar verschrumpelte Kartoffeln und Möhren anzubieten, andere Snickers und Bounties zweifelhaften Herstellungsdatums, Quarzuhren, Parfüm aus Frankreich oder eingelegte Kürbisse und Trockenfisch – also alles, was es in den staatlichen Läden nicht oder selten gibt! Allerdings kosten ein Pfund Tomaten, Zwiebeln oder ein paar eingelegte Salzheringe, die fast jeder Stand verkauft, gleich einen halben Monatslohn.
Von der berühmten Sophienkirche oder der alten Festung mit dem Höhlenkloster, der ältesten Abtei des Ostens, bekommen wir im nächtlichen Kiew nichts zu sehen, stattdessen graue Betonsiedlungen, aufgerissene, breite, unbeleuchtete Straßen fast ohne Verkehr. Einmal fahren wir über eine Brücke, überqueren den Dnjepr, der an dieser Stelle einen Kilometer breit ist. Schließlich biegen wir von der Straße ab, ratternd und knallend rüttelt uns der alte Skoda durch ein Industriegebiet, an einem Güterbahnhof vorbei, dann ein Wohnviertel, wo 50er-Jahre-Klötze zu Carées angeordnet sind, bis wir einen schmalen Weg mitten in so ein Geviert hineinfahren und vor einem schwach beleuchteten Eingang halten. Unser Fahrer murmelt etwas und verschwindet, eine dreiviertel Stunde lang warten wir, sehen gelegentlich im dritten Stock ein Licht an-, wieder ausgehen und überlegen, ob da oben über unseren Kopf verhandelt wird. Es ist halb vier Uhr morgens. Einmal gehen zwei Männer in den Keller, poltern schamlos herum, kehren mit zwei leeren Kanistern und einem ausgebauten Autotank zurück und verschwinden im Treppenaufgang. Nach einer Stunde kommt der Fahrer, beladen mit jetzt vollen Kanistern und dem Tank, grinst wie ein Sieger und fragt, ob wir was dagegen haben, wenn seine Frau mitfährt. Die Frau hat auch uns beruhigt, im Auto dösen wir auf der Rückbank beide ein, während wir vorher schon die Wache ausgelost hatten.
So kamen wir nach Charkow.
Abends einen draufmachen? Tote Hose.
Eine knappe Woche haben wir hier verbracht. Wir wollten die Geschichte der jüdischen Gemeinde erkunden, haben den über 80jährigen Rabbi Israel Abramowitsch Ioffe kennengelernt und die wenigen aktiven Mitglieder seiner Gemeinde. Wir wohnten bei einem befreundeten Fotografen, der die ganze Woche nicht in die Arbeit ging. Er hatte einfach angekündigt, eine „deutsche Delegation“ begleiten zu müssen, damit war der Fall erledigt. Mit Frau und Tochter besaß er eine drei Zimmer Wohnung, die noch immer staatlich subventioniert und deshalb erschwinglich war. Wenn man warm duschen wollte, mußte man auch in der Küche den Hanh aufdrehen, weil sonst im Bad die Boilerflamme ausgeht und das Gas weiterströmt – ein Vorgang, dessen technisches Geheimnis er uns nicht erklären konnte.
In einem Café trafen wir den bleichen Ingenieur Sergej, der einst im wenige hundert Kilometer entfernten Tschernobyl den ersten Aufräumungseinsatz der Soldaten leitete und jetzt, von der Regierung mit Wohnung, Auto und Rente versorgt, auf seinen baldigen Tod wartet. Im selben Café saß eine Gruppe Sportstudenten, die sich zusammen drei Getränke teilten. Wir plauderten ein wenig, schließlich drucksten sie herum, um dann zu fragen, was hier nahezu jeder wissen will: „Wie komme ich nach Deutschland?“
Einmal wollten wir uns abends amüsieren und suchten Stunden nach einem Lokal, das nicht um neun geschlossen hat. Am Ende landeten wir erlebnishungrig in einem Nachtlokal, wo Striptease groß angekündigt und eine Folklore-Tanzshow gezeigt wurde. Spät am Abend hat mir ein Mafiosi seine „Freundin“ – „You know, she is crazy for you!“ – angeboten. Die anderen Gäste waren jene sich wichtig gebenden Männer, die sich laut unterhielten, die Bedienungen belästigten und ab und an zur Bühne gingen, um den Tänzerinnen lässig ein Bündel Geldscheine zuzuwerfen.
Am Tag meiner Abreise eröffnete uns unser Gastgeber Igor, daß er nur deshalb die ganze Woche frei hatte, weil er an seinem Arbeitsplatz versprochen hatte, daß er seine Journalistengäste einmal mitbringen würde. Der Besuch sei reine Formsache, in einer Viertelstunde zu erledigen. Im „Institut für Straßenbau und Fahrzeugwesen der technischen Hochschule Charkow“, wo Igor als Photograf für das Archiv beschäftigt war, hatte man sich allerdings mehr vorgestellt. Eine eigene Dolmetscherin stand bereit, um vier wichtige Herren vorzustellen, die uns mit Errungenschaften wie neuen Asphaltierungstechniken und den aus der ehemaligen DDR stammenden Laborausstattungen bekannt zu machen. Wir hatten ja bereits Gelegenheit, die Notwendigkeit insbesondere moderner Straßenpflasterei zu erkennen, denn in Charkow gibt es keine Straße, wo der Belag nicht durch kraterähnliche Löcher unterbrochen oder um die Straßenbahnschienen herum zentimetertief abgesunken ist.
Der falsche Zug
Vor meiner Abreise wollten wir noch schnell zum großen Wochenmarkt, wo hunderte privater Händler alles verkaufen, was es sonst nirgends gibt: frisches Gemüse, Zitrusfrüchte, Uhren, Westklamotten, leere Benzinkanister, Autoersatzteile, Computer-Software, in einer eigenen Halle Fleisch und Geflügel. Halb Charkow drängelte sich auf den Markt, ein Wunder, wenn man bedenkt, daß ein Huhn einen guten Wochenlohn kostet. Als wir uns durch das Gewühl in der Fleischhalle schieben, gibt es direkt vor uns einen Aufruhr: ein Schrei und von allen Seiten springen Männer über die auf Tischen ausgelegten Hühner, Lämmer, Schweinehälften. Einhellig stürzen sie sich auf einen Mann, der erfolglos versucht, sich mit einer gestohlenen Lammkeule aus dem Staub zu machen. Von allen Seiten prasseln Fausthiebe auf ihn nieder, er strauchelt, erhält noch einen Tritt und kann sich dann durch einen Seitenausgang retten.
Wenige Stunden später stand ich auf dem Bahnhof, um den Zug nach Kiew zu nehmen. Unser Dolmetscher Sergej, ein 22jähriger, strebsamer Germanistikstudent, der uns die Woche über kompetent begleitet hatte, setzte mich in das Abteil, zeigte dem Schaffner meine Platzreservierung und kämpfte meinen Sitz frei. Der Zug platzte buchstäblich aus allen Nähten, in den Gängen standen dicht gedrängt die Menschen, auf jedem schmalen Gepäckbrett lag ein Schlafender. Die Sitzplätze waren fast ausschließlich von Männern besetzt; Frauen saßen, wenn überhaupt, auf dem Schoß ihres Mannes. Es war ein Bummelzug, für den dieser Name hätte erfunden sein können: wo immer drei Häuser am Gleisrand standen, hielt er an, kaum jemand stieg aus, aber wunderlicherweise dauernd neue Fahrgäste zu. Irgendwann bot ich einem jungen Mädchen, das hochschwanger war, meinen Platz an. Ihr Freund hatte ihr anfangs noch beruhigend den Bauch getätschelt, um bald darauf in die oberste Etage der Gepäckbretter, nur Zentimeter unter dem Wagendach, zu verschwinden, wo er seelenruhig schnarchte. Nach etwa sechs Stunden begann sich der Zug zu leeren.
Um mir die Beine zu vertreten, schlenderte ich durch die Waggons, da traf ich unseren Schaffner wieder. Mehr um ein paar Worte zu sprechen, als aus wirklichem Interesse, fragte ich, wann denn der Zug in Kiew ankäme. Erst verstand er nicht, doch ein älterer Herr, der sehr gut Englisch sprach, übersetzte, mit einem erstaunten Blick. Die Antwort verstand auch ich: „Kiew? Njet!“ Erst hielt ich das für den berühmten schwarzen Humor der Slawen, doch der Schaffner war Tadschike und machte keine Scherze. Unser Dolmetscher hatte mich in den falschesten aller Züge gesetzt, der in die entgegengesetzte, in östliche Richtung fuhr. Ein junges Mädchen, das ein wenig Englisch sprach, mischte sich ein. Bei der nächsten Station müsse sie aussteigen, sie könne mir ein Quartier besorgen und am Abend des darauffolgenden Tages führe derselbe Zug zurück nach Charkow. Beim nächsten Halt, nur wenige Kilometer entfernt, dreihundert Kilometer östlich von Charkow, nahe der russischen Grenze, verließ ich mit ihr den Zug. Ich muß gestehen, daß ich den Namen dieser ostukrainischen Kleinstadt niemals nachgefragt habe; ihn bis heute nicht kenne. Man geht von der Haltestelle des Zuges ein paar hundert Meter bis zum eigentlichen Bahnhof, dort gibt’s zwei Fahrkartenschalter, ein paar Holzbänke, einen Parkplatz, auf dem Busse und Taxis stehen und sonst nichts. Ich machte meiner Begleiterin Sonia klar, daß ich auf keinen Fall hier übernachten könne, dringende Geschäfte erforderten meine Anwesenheit in Deutschland. Das Wort ‚business‘ hat im ganzen Osten einen magischen Klang, verständnisvoll nickte sie dazu, verschwand auf dem Bahnhofsplatz, wo sie bald einen Busfahrer, dann eine Gruppe Taxifahrer beschwatzte. Ein Bus sei vor einer Stunde nach Charkow aufgebrochen, ob ich nicht doch auf den Zug warten könne? Nein, das auf keinen Fall… ob vielleicht ein Taxifahrer…? Neue Verhandlungen. Ein junger Mann, ein gutmütig wirkender Riese in einer beigen Kordjacke, erklärte sich bereit: Wir einigten uns auf 50 Dollar. Sonia machte große Augen, 50 Dollar, das ist eine Summe, die sie in jahrelanger Arbeit nicht verdienen, geschweige denn zurücklegen könnte. Arbeiter, Journalisten, Lehrer oder Angestellte verdienen umgerechnet 3-4 DM im Monat.
Um sieben Uhr abends verließ ich mit meinem Fahrer Piotr die Stadt Richtung Westen. Kurz nach zehn ließen wir das Lichtermeer von Charkow rechts liegen. Bis hierher kannte er den Weg, der Rest war Glückssache, denn Wegweiser stehen nur sporadisch an den Kreuzungen. Nie werde ich die Nacht vergessen. Die Stunden vergingen, auf den schmalen, schadhaften Landstraßen konnten wir selten schneller als 60, oft nur 40 fahren, Piotr war sichtlich um seinen Lada besorgt. Um 6.20 sollte mein Zug von Kiew nach Prag starten. Piotr sprach nur Russisch und Ukrainisch, unsere Unterhaltung beschränkte sich bald darauf, daß er mit einem Fingerschnippen um eine Zigarette bat. Gelegentlich donnerten entgegenkommende Lastzüge an uns vorbei, sonst waren die Straßen leer. Um 4.45 erreichten wir den Stadtrand von Kiew, nach einigen Irrwegen überredete Piotr einen alten Mann mit Angel und Köscher, uns den Weg zu zeigen, mühsam quetschte er sich auf den Rücksitz. Irgendwann tauchte vor uns die Silhouette des Bahnhofs auf. Rasch umarmte ich Piotr, dann hastete ich in die Halle.
Flucht aus Kiew
In Kiew gelangt man zu den Gleisen über eine lange Brücke mit einer gläsernen Kuppel als Dach, von oben kann man auf die Züge blicken. Manchmal erweitert sich die Brücke zu einer Halle, wo auf allen Plätzen Menschen sitzen oder schlafen. Es war 5.26, eine knappe Stunde vor der angekündigten Abfahrt des Zuges, als ich direkt über dem Gleis 10 stand und gerade noch sah, wie der Zug Moskau-Kiew-Prag den Bahnhof verließ. Man hatte mir in Charkow die falsche Abfahrtszeit genannt. All die Hatz, die Angst umsonst, die Erleichterung eine tückische Finte. Ich saß auf meinem Gepäck, ich war nicht müde, nicht traurig, nicht wütend, nur einfach leer. Damals fuhren die Züge noch nicht täglich sondern dreimal die Woche nach Prag. Am Schalter, wo ich mich nach Auswegen erkundigte, erkannte ein Taxifahrer mit geschulten Blick meine Hilflosigkeit. Er empfahl mir, mit dem Flugzeug nach Lwow an der ukrainisch polnischen Grenze zu fliegen und dort eine Nacht auf den Zug zu warten. Im Geiste sah ich Lwow vor mir: Ein trister Bahnhof, ein schmutziges Hotel, in dem man mir sicher 100 Dollar für die Nacht abknöpfen würde – nein, genug! Erwartungsvoll sprach der Fahrer auf mich ein, faßte mich beim Reden dauernd am Ärmel an, zupfte daran, scheinheilig erschien mir sein Blick. Kiew hat zwei Flughäfen, einen für Flüge innerhalb der ehemaligen Sowjetunion, einen für solche in den Rest der Welt. Der liegt etwa 30 Kilometer außerhalb, ich hatte ihn im Morgengrauen schon einmal passiert. Dorthin wollte ich gebracht werden. Wir saßen kaum im Wagen, als mir der Fahrer eröffnete, daß er dafür 30 Dollar wollte. Ich war mit Piotr 800 Kilometer durch die Nacht gefahren, für 50 Dollar. Mit einem Hauptstadtaufschlag mußte gerechnet werden, aber das war – eine Unverfrorenheit. Ich hatte genug von diesen Typen, diesen Taxifahrern-Kellnern-Hotelbediensteten-Beamten, die in jedem Westler einen verblödeten Goldesel wittern, den es nach Kräften zu schröpfen gilt. Ich brüllte ihn auf Deutsch an: „Fahr mich sofort zum Bahnhof zurück und nimm Deine dreckigen Pfoten weg!“ Er beschimpfte mich ebenfalls, „this is the price! You never come back to Germany“. Es klang wie „Tscher-Money“. Ich machte Anstalten, die Tür des fahrenden Wagens zu öffnen, da wendete er. Plötzlich war er wieder freundlich, half mir beim Ausladen und fing wieder mit dem Tätscheln an. Ich riß mich wütend los und sah zu, wie er kopfschüttelnd in der Menge verschwand.
Zwei Stunden später war ich am Flughafen. Das Taxi hatte ich mir mit einem in der Ukraine geborenen, seit 15 Jahren in Athen lebenden Makler für Olivenöl geteilt, für 10 Dollar. „Weißt Du, erzählte er, hier kann man noch echte Geschäfte machen. Die kaufen nicht ein paar Fässer Olivenöl sondern ganze Lastzüge. Du mußt nur die richtigen Leute kennen, Vertrag per Handschlag und alle zahlen bar.“
Auch der Flughafen war auf ukrainische Art organisiert. Sämtliche Toiletten bis auf eine befanden sich im Umbau. Die Anzeigetafel der Abflüge zeigte den Winterfahrplan an, der seit Monaten nicht mehr galt…
Ich hatte keine 1100 Mark mehr für den Rückflug. Der Himmel sandte mir Herrn Schaak, den freundlichen Serviceleiter der Austria Airlines in Kiew. Der ließ mich so oft das Funktelefon benutzen, bis ich meine Frau im unendlich fernen, wundervollen Fürth erreichte. (Anrufe ins Ausland muß man sonst anmelden und zwölf Stunden darauf warten.) Die kaufte mir in Nürnberg ein Ticket und ließ es per Fax anweisen – welch wundervolle Möglichkeiten die moderne Welt doch bietet.
Irgendwann saß ich im Flugzeug nach Wien mit einem doppelten Whiskey in der Hand. Ich erinnere mich wie heute daran, daß der Pilot gesagt hatte: „Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten werden wir die ukrainische Grenze passieren. In Wien war heute ein sonniger Frühlingstag, wenn sie ankommen, wird es noch etwa 15 Grad haben.“